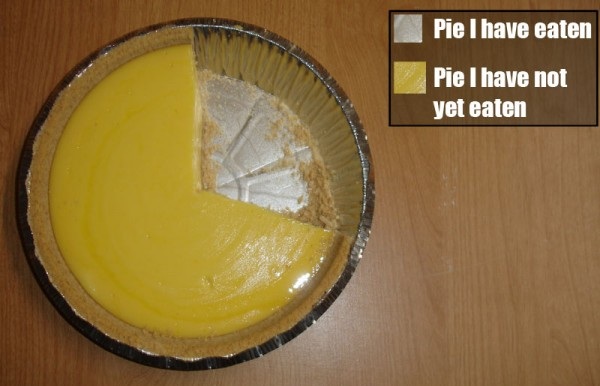Ich mag das Wort „Echolot“. Das Lied „Echolot“ von „Wir sind Helden“ höre ich gern wenn ich joggen gehe, am Zürichsee entlang – zur Roten Fabrik und wieder zurück. Dann schau ich auf das graue Wasser, fühle den Schnee unter meinen Füssen und mein Herz schlägt bis knapp zum Hals. Und in meinem Ohr das Lied:
Halt still
Das Bett ist ein Floss
Und ich will
Raus auf’s Meer komm schneid es
Los schau
Unter uns flüssiges Blei
Graue
Schatten ziehen träge vorbei
Sterne und Wasser
Und wir dazwischen
Komm, wir schwimmen
Mit den grossen Fischen
Ich seh dein Herz
Dein Echolot
Schlägt Wellen in die See
Ich seh dein Herz
Ich weiss wir gehen
Tiefer auf den Grund
Komm schau
Um uns tanzt glitzernder Staub
Wir
Sinken selig und taub
Stumm wartend und leise
Ziehen Schatten engere Kreise
Sterne und Wasser
Und wir dazwischen
Komm, wir schwimmen
Mit den grossen Fischen
Ich seh dein Herz
Dein Echolot
Schlägt Wellen in die See
Ich seh dein Herz
Das bisschen rot
Tut nicht lange weh
Ich seh dein Herz
Bleib noch nicht stehen
Ich häng an deinem Mund
Ich seh dein Herz
Ich weiss wir gehen
Tiefer auf den Grund
Izzie hat mich ja überredet am Silvesterlauf mitzumachen. Von der Strecke her und so kein Problem. Und trotzdem bin ich aufgeregt. Wir werden – auf meinen Wunsch hin – in der Kategorie „Happy Runners“ laufen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich dann wirklich so „happy“ bin. Wir werden sehen…
Übrigens eine sehr interessante Woche – mal wieder. Am Dienstag war ich zusammen mit PMO im Casinotheater Winterthur das „Gipfeltreffen“ von Jess Jochimsen und Andreas Thiel schauen. Hat mir sehr gefallen. Der Abend dauerte lang und hat grossen Spass gemacht. Am Mittwoch verbrachte ich zusammen mit Biene einen Abend mit unserem „Patenkind“ aus Afghanistan. Morteza (so heisst unser „Patenkind“) ist 17 Jahre alt und lebt in einem Asylantenheim im Thurgau. Da er keine Unterstützung von der Gemeinde bekommt (ich könnte mich zu Tode ärgern), haben wir uns ihm angenommen, bezahlen ihm einen Deutschkurs und schauen, dass er nicht auf die schiefe Bahn gerät. Er spricht schon wahnsinnig gut Deutsch und wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Was ich mich immer wieder frage: Wie kann man nur einen Minderjährigen in ein Heim stecken mit alles Erwachsenen und ihn dann sich selbst überlassen? Ich fasse es nicht… Morteza hat uns viele Geschichten aus seiner Heimat erzählt (wie er Steinigungen miterlebt hat, zum Beispiel) und wollte alles über die Schweiz wissen.
Manchmal braucht es nicht viel. Und das Bisschen hilft dann doch ne ganze Menge…